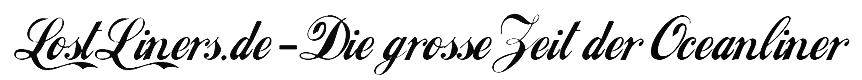|
Hamburg/Deutsche Atlantic Linie |
 |
von Thorsten Totzke

Bierdeckel der ersten Hanseatic
Sammlung Thorsten Totzke
Gründer der Hamburg-Atlantik Linie war der Däne Axel Bitsch-Christensen, der gemeinhin "ABC" genannt wurde. Er gelangte 1952 als Repräsentant der Home Lines nach Hamburg.
Im November 1957 gelang es "ABC" von dem damaligen Hamburger Bürgermeister Max Brauer die Zusage einer Bürgschaft über 16,5 Millionen Mark zu bekommen. Sein Chef und Freund Nicos Vernicos Eugenides stellte ihm 6 Millionen Mark als Gründungskapital für die neue Reederei zur Verfügung.
So konnte am 06. Januar 1958 die Hamburg-Atlantik Linie GmbH offiziell eingetragen werden.

Streichhölzer der ersten Hanseatic
Sammlung Thorsten Totzke
Durch geschickte Vorverhandlungen war es möglich, bereits am 17. Januar 1958 von der Canadian Steamship Ltd. deren Empress of Scotland zu erwerben. Das Schiff wurde in Hamburg komplett umgebaut und renoviert und konnte 19. Juli 1958 unter dem Namen Hanseatic seine Jungfernfahrt antreten.

Die zweite Hanseatic im Sonnenuntergang
Sammlung Thorsten Totzke
Die Berechnungen der Reederei sahen vor, dass die Hanseatic pro Jahr auf 12 Transatlantikreisen 8,4 Millionen Mark verdienen musste, von denen 6 Millionen der Kapitaltilgung und für Zinsen dienten. Nach zwölf Jahren würde das Schiff damit schuldenfrei sein.
Am 15. August 1958 trat der Hamburger Zigarettenfabrikant Phillip F. Reemtsma offiziell in die Hamburg-Atlantik Linie ein. Er beteiligte sich mit vier Millionen Mark, so dass das Stammkapital sich auf 10 Millionen Mark erhöhte.

An Deck der ersten Hanseatic
Sammlung Thorsten Totzke
Offiziell war die Reederei nun als "Hamburg-Atlantik Schiffahrts-Gesellschaft mbH" eingetragen. Es blieb im Geschäftsverkehr aber bei der alten Bezeichnung.
Bereits im Januar 1959 erkannte Bitsch-Christensen, dass die Wintermonate zu wenig Passagiere für den Transatlantikdienst boten. Also wurde die Hanseatic auch für Westindien-Kreuzfahrten von New York aus eingesetzt.

Die Brücke der ersten Hanseatic
Sammlung Thorsten Totzke
1962 begann Axel Bitsch-Christensen aufgrund des Erfolges der Hanseatic über den Bau eines zweiten Schiffes nachzudenken. Als er im Hamburger Rathaus um eine weitere Bürgschaft bat, war man dort nicht sonderlich interessiert. Allerdings gab Finanzsenator Weichmann zu erkennen, dass über eine Bürgschaft nachgedacht werden könne, wenn die Reederei 30 Millionen Mark Eigenkapital aufbringen könne.
Bitsch-Christensen setzte sich daraufhin mit Walter Hoffmann, seinem Finanzberater und früherem Hapag Chef, zusammen, welcher das Konzept einer Abschreibungsgesellschaft entwarf.
750 ehemalige Hanseatic-Passagiere wurden angeschrieben, von denen 256 innerhalb von 2 Wochen 20 Millionen Mark zusagten.
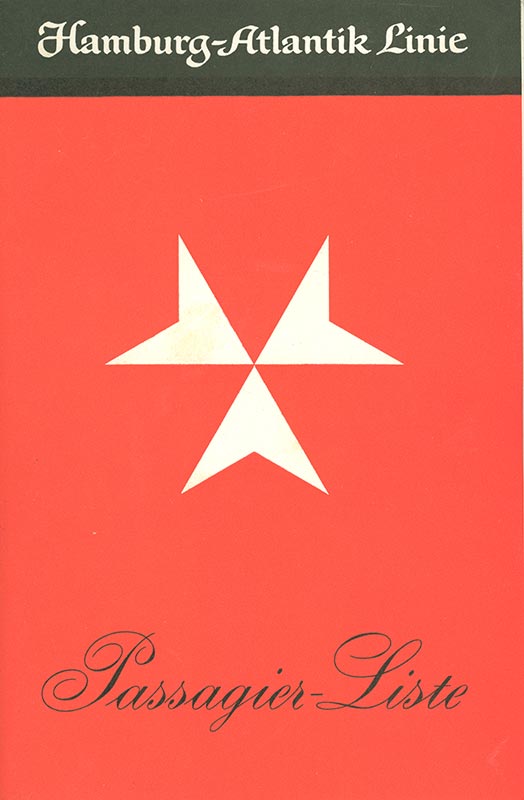
Passagierliste
Sammlung Thorsten Totzke
Damit konnten ernsthafte Planungen begonnen werden. Im September verschickte die Reederei an potentielle Anleger ein ausführliches Beteiligungsprospekt. Am 01. Dezember 1965 fand in Hamburg die erste Versammlung der "Deutschen Atlantik-Schiffahrtsgesellschaft GmbH & Co." Statt, bei der 212 private Anleger 30 Millionen Mark zeichneten, obwohl Zusagen auf staatliche Hilfen noch nicht vorlagen.
Von nun an hieß die Reederei Deutsche Atlantik Linie. Im Februar 1966 kam vom Bund die Zusage über eine Bürgschaft mit der Bedingung, dass das neue Schiff auf der größtenteils bundesdeutschen Deutschen Werft in Hamburg gebaut werde.
Der Hamburger Senat sagte zu, seine Entscheidung bis Spetmeber 1966 zu fällen. Zwischenzeitlich passierte ein Unglück: In New York brannte die Hanseatic aus und wurde zum Totalverlust.
Um die bereits gebuchten Kreuzfahrten durchführen zu können, charterte die Reederei kurzerhand das französische Schiff Renaissance.

Hanseatic
Sammlung Thorsten Totzke
Im September gab der Hamburger Senat seine Einverständniserklärung zu der Bürgschaft, und im Oktober stimmte die Gesellschaftsversammlung der Deutschen Atlantik Linie dem Neubau zu.
Nun wurde der Auftrag bei der Deutschen Werft platziert. Anfang 1967 wurde eine neue Eigentümergesellschaft gegründet, die "HANSEATIC Schiffahrts-Gesellschaft mbH", deren Kapital wiederum von ehemaligen Hanseatic Passagieren gestellt wurde. Von diesem Geld wurde im Mai 1967 die israelische Shalom gekauft und im November als Ersatz für die Hanseatic ebenfalls unter dem Namen Hanseatic in Dienst gestellt.

Kofferanhänger
Sammlung Thorsten Totzke
Im April 1967 nahm die Deutsche Atlantik Linie Verhandlungen mit dem Norddeutschen Lloyd auf, um einen abgestimmten Fahrplan zu realisieren und so zu beiderseitigem Vorteil die Transatlantikfahrten der Schiffe beider Reedereien zu koordinieren. Am 30. Mai 1967 erklärte sich der Norddeutsche Lloyd unter Leitung von Richard Bertram zu Verhandlungen bereit.
Die Verhandlungen gediehen so gut, dass im Herbst bereits gemeinsame Kreuzfahrtprospekte in den Reisebüros auslagen.
Am 15. Dezember 1967 äußerten sich die beiden Reedereien in einer gemeinsamen Pressemitteilung zuversichtlich über die Zusammenarbeit. Doch dann kam es Anfang 1968 zu Differenzen zwischen Bertram und Bitsch-Christensen über die Ertragskraft der einzelnen Schiffe. Christensen schätzte seine beiden Schiffe (die Hanseatic und die im Bau befindliche Hamburg) höher ein als die beiden alten Schiffe des Norddeutschen Lloyd (Bremen und Europa).
Dies mag berechtigt gewesen sin, wurde aber vom Norddeutschen Lloyd nicht anerkannt, der damit die Zusammenarbeit beendete. Im Mai versuchte das Bundesfinanzministerium noch einmal, beide Parteien an einen Tisch zu holen, doch auch dieser Versuch scheiterte.
Der Norddeutsche Lloyd schrieb in seinem im Juli 1968 erschienenen Geschäftsbericht für das Jahr 1967 lediglich, die beabsichtigte Zusammenarbeit habe sich nicht verwirklichen lassen.
Im Februar 1968 war der Neubau Hamburg vom Stapel gelaufen und konnte Ende März 1969 seine Jungfernfahrt antreten.

Bordpass
Sammlung Thorsten Totzke
Doch bereits im Herbst 1969 deutet sich das Ende der Reederei an. Durch die Aufwertung der Deutschen Mark begann die Reederei schwere Verluste zu machen. Da ca. 75% der Einnahmen in Dollar gemacht wurden, bedeutet jedes Prozent Aufwertung einen Verlust von über 200 000 Mark. Außerdem steigen die Personalkosten deutlich an.
Von 1968 bis Ende 1970 allein um 34%. Erwirtschaftete die Reederei 1970 noch 16 Millionen Mark, so waren es 1971 nur noch 14 Millionen. 1973 war die Deutsche Atlantik Linie in schweren finanziellen Nöten. Seit 1968 waren die Personalkosten um 70% gestiegen und die Brennstoffpreise um 50%. Dazu fiel der Dollar im Verhlätnis zur Mark immer weiter. Sämtliche Wirtschaftlichkeitsrechnungen waren mit einem Kurs von 3,80 DM für einen Dollar gemacht worden. Nun lag der Dollar nur noch bei 2,60 Mark.
Die Reederei nahm Verhandlungen mit der Hapag-Lloyd AG auf, um sich mit ihr zu verbinden. Diese lehnt jedoch ab. Im Juli 1973 musste die Hanseatic an die Home Lines verkauft werden, um den Bankrott vorübergehend abzuwenden.
Im September 1973 wurden die Schulden der Deutschen Atlantik Linie auf 50 - 70 Millionen Mark geschätzt. Die größten Gläubiger waren die Hamburgische Landesbank mit 28 Millionen und die Kreditanstalt für Wiederaufbau mit 20 Millionen Mark. Der Hamburger Staat hatte sich für Hypotheken in Höhe von 33 Millionen Mark verbürgt. Kurt A. Körber, Beiratsvorsitzender der Reederei, bezeichnete die Lage als schwierig, aber nicht hoffnungslos.
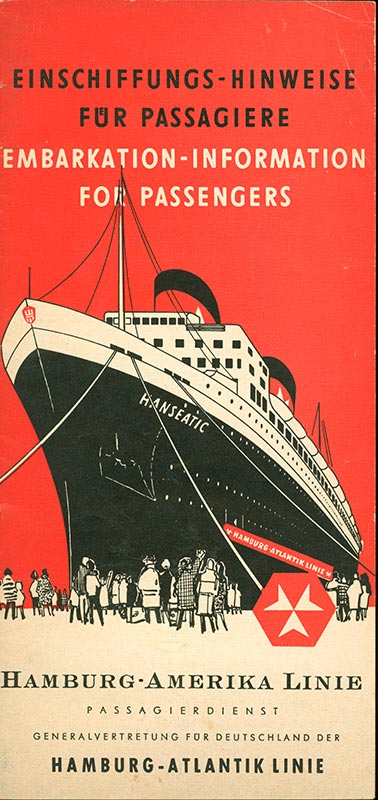
Einschiffungshinweise
Sammlung Thorsten Totzke
Die Gläubiger seien nicht in Gefahr, und man verhandle man über eine Stundung der Ende 1973 fälligen Tilgungsrate von 7 Millionen Mark. Notfalls seien die Kommanditisten bereit, diese Summe aufzubringen.
Am 25. September 1973 handelte sich die Reederei in der Öffentlichkeit erhebliche Sympathieverluste ein, als sie die HAMBURG, nach der Übergabe der Hanseatic an die Home Line, in HANSEATIC umbenannte, um auch weiterhin mit dem Namen Hanseatic werben zu können. Dieses Handeln trug eigentlich nur zur öffentlichen Verwirrung bei und brachte keinerlei Vorteile. Nun versuchte man, die Hanseatic ex Hamburg zu verkaufen. Hierzu wurden als erstes Verhandlungen mit Hapag-Lloyd aufgenommen, aus denen man Bitsch-Christensen aber aufgrund der Ereignisse von 1968 heraushielt.
Da er der Reederei nicht mehr nützlich war, trennte man sich im gegenseitigen Einvernehmen. Der Beiratsvorsitzende Kurt A. Körber trat seine Nachfolge an. Die finanzielle Absicherung der Reederei wurde immer schlechter, so dass die Gesellschafter im Oktober 1973 keinen anderen Ausweg sehen, als die Auflösung der Reederei zu beschließen.
Die Hanseatic sollte für 50 Millionen Mark an Hapag-Lloyd verkauft werden, womit alle Verbindlichkeiten gegenüber dem Staat abgedeckt wären, allerdings die Gesellschafter ihre Einlagen und Darlehen verloren hätten.

Hanseatic in der Südsee
Sammlung Thorsten Totzke
Im November kam mitten in den Verhandlungen mit der Hapag-Lloyd ein Angebot aus Japan, das sehr viel höher als das Angebot vom Hapag-Lloyd war.
Am 01. Dezember 1973 stellte die Deutsche Atlantik Linie ihren Betrieb ein. Die Hanseatic ex Hamburg wurde in Hamburg aufgelegt.
Am 12. Dezember wurde auf einer Gesellschaftsversammlung über den Verkauf des letzten Schiffes diskutiert.
Es lagen zwei Angebote vor: Das der japanischen Ryutsu Kaiun K.K. und eines von der amerikanischen Robin International Cooperation. Von der amerikanischen Firma wusste man, dass sie die Hanseatic für die sowjetische Staatsreederei erwerben sollte.
Es wurde beschlossen, den Japanern für 67,5 Millionen Mark den Zuschlag zu geben. Leider war der Vertrag der Japaner unvollständig. Es fehlte die entscheidene Unterschrift des Ryutsu-Chefs. So bekam die amerikanische Firma den Zuschlag - allerdings nur für 62 Millionen Mark.
Wie erwartet gaben die Amerikaner das Schiff an die Sowjetische Staatsreederei weiter. Am 25. Januar 1974 wurde die Hanseatic an die Black Sea Shipping Co. übergeben und in Maksim Gorkiy umbenannt.
Damit endete der Bestand der letzten deutschen Reederei, die einen transatlantischen Liniendienst anbot.